
Artikel in Sammelbänden und Fachzeitschriften
- Kadenz- und Zeitgestaltung in Frobergers Meditation sur ma mort future, in: Musik & Ästhetik 80, 2016.
- Varietas und ratio in Ockeghems Missa Quinti toni, in: Musik & Ästhetik 86, 2018.
- Carl Philipp Emanuel Bachs Fantasien, oder: Von der »Wissenschaft der Harmonie«, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie (ZGMTH), 17. Jg., Nr. 2, 2020.
- Vergeistigte Tanzmusik. Zur innovativen Metrik in Johann Jakob Frobergers Sarabanden, in: GMTH Proceedings 2017 [17. Jahreskongress der Gesellschaft für Musiktheorie und 27. Arbeitstagung der Gesellschaft für Popularmusikforschung, Graz 2017], hg. v. Florian Edler und Markus Neuwirth, 2021.
- Joseph Haydns »angenehme Verwirrung«, in: Musik & Ästhetik 97, 2021.
- Das Menuett als Klangrede. Ein Beitrag zur Didaktik der Improvisation, in: Tanz und Musik. Perspektiven für die Historische Musikpraxis, hg. v. Christelle Cazeaux, Martina Papiro und Agnese Pavanello, 2024.
Rezensionen
- Motivisch-thematische Arbeit als Inbegriff der Musik?, in: Musik & Ästhetik 82, 2017.
Bücher

Kadenz und Gegenwart.
Satztechnik und Zeitgestaltung in den Allemanden J.J. Frobergers
Der vorliegende Band widmet sich einer auf neuartige Weise intensiven wie historisch fundierten Analyse der Froberger'schen Musik am Beispiel der für sein Schaffen zentralen Gattung der Allemande. Denn ausgerechnet Tanzmusik erscheint bei Froberger auf bis dahin ungeahnte Weise vergeistigt. Die Auseinandersetzung mit seinen Allemanden führt durch das Dickicht der elaborierten Satztechnik, über Fragen der Zeitgestaltung, hin zur Dechiffrierung ihrer existenziellen Dimension, der subjektiven Erfahrung von Zeit und Zeitlichkeit. Aus der Perspektive des Zeiterlebens wird das Phänomen »Tonalität« neu beleuchtet und eine Brücke zwischen Kompositions- und Geistesgeschichte geschlagen, sodass die Musik Frobergers in doppeltem Sinne gegenwärtig erscheint.
Satztechnik und Zeitgestaltung in den Allemanden J.J. Frobergers
Der vorliegende Band widmet sich einer auf neuartige Weise intensiven wie historisch fundierten Analyse der Froberger'schen Musik am Beispiel der für sein Schaffen zentralen Gattung der Allemande. Denn ausgerechnet Tanzmusik erscheint bei Froberger auf bis dahin ungeahnte Weise vergeistigt. Die Auseinandersetzung mit seinen Allemanden führt durch das Dickicht der elaborierten Satztechnik, über Fragen der Zeitgestaltung, hin zur Dechiffrierung ihrer existenziellen Dimension, der subjektiven Erfahrung von Zeit und Zeitlichkeit. Aus der Perspektive des Zeiterlebens wird das Phänomen »Tonalität« neu beleuchtet und eine Brücke zwischen Kompositions- und Geistesgeschichte geschlagen, sodass die Musik Frobergers in doppeltem Sinne gegenwärtig erscheint.
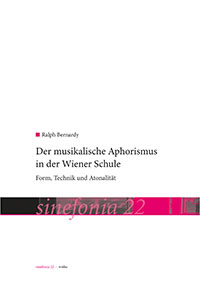
Der musikalische Aphorismus in der Wiener Schule
Form, Technik und Atonalität
Mit den zwischen 1909 und 1914 komponierten kurzen Instrumentalstücken der Wiener Schule erfährt der literarische Aphorismus sein genuin musikalisches Pendant. Die Arbeit beschäftigt sich mit den Voraussetzungen des aphoristischen Stils sowie dessen Ausprägung in formaler, materieller und kompositionstechnischer Hinsicht anhand dreier ausgewählter Kompositionen. Die Analyse zeigt die unterschiedlichen Strategien der Komponisten und stellt Verbindungen zu Schumanns Träumerei her, ohne systematisierte Methoden vorzuschreiben.
Form, Technik und Atonalität
Mit den zwischen 1909 und 1914 komponierten kurzen Instrumentalstücken der Wiener Schule erfährt der literarische Aphorismus sein genuin musikalisches Pendant. Die Arbeit beschäftigt sich mit den Voraussetzungen des aphoristischen Stils sowie dessen Ausprägung in formaler, materieller und kompositionstechnischer Hinsicht anhand dreier ausgewählter Kompositionen. Die Analyse zeigt die unterschiedlichen Strategien der Komponisten und stellt Verbindungen zu Schumanns Träumerei her, ohne systematisierte Methoden vorzuschreiben.